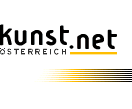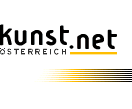|
Bruno Gironcoli, geboren 1936 in Villach, aufgewachsen in Kärnten
und Tirol, Goldschmiedelehre in Innsbruck, mit Gesellenprüfung
abgeschlossen (1951-56).
Studium an der Akademie für angewandte Kunst in Wien bei Prof.
E. Bäumer
(1957-59 bzw. 1961-62).
Aufenthalt in Paris (1960-61).
Beginnt 1961 mit Objekten aus Holz, Nylon, Eisen, Aluminium, Glas,
Pech.. etc. sowie mit Drahtobjekten, ab 1964 Polyester-Arbeiten,
1967 erste Einzelausstellung in der Galerie Hildebrand, Klagenfurt.
Seit 1977 Professor an der Akademie der bildenden Künste in
Wien, als Nachfolger von Prof. Fritz Wotruba Leiter der Meisterschule
für Bildhauerei.
Er erhält 1989 den erstmals vergebenen "Österreichischen
Skulpturenpreis der Erste Allgemeine Generali-Foundation.„
Gironcoli schrieb in einem Brief vom 2. Mai 1977
"Wichtig für mich ist: die handwerkliche Arbeit als
Bewältigung von Zeit; die Finanzierung dieser Arbeit in einer
diesen Dingen gleichgültig gegenüberstehenden Umgebung
als abenteuerliche Selbstbestätigung- immer am Rande des Bankrotts.
Und als letztes die investierte Zeit, Arbeit und Geld in ein begonnenes
Stück, von dem ich anfangs ein Bild habe, das sich aber in
der Materialisierung verwischt und damit das Spiel, gegebene Kraft
und Material zu retten, beginnt. Um Arbeitszeit zu gewinnen, der
rückschrittliche Griff zur Skulptur."
Bei Bruno Gironcoli ist der Arbeitsweg eine langfristige Entscheidung
und ein langfristiges Unternehmen zu einer bestimmten Situation,
die sich in einer bildhauerischen Idee bindet oder wandelt. Seine
körperlichen Veränderungen, das Altern in Verbindung mit
seinen Absichten sind, sowie als Zweitberufsarbeiter, der für
seinen Erstberuf Geld verdient, alles Formen als Arbeitswege. Gironcoli
hat sich entschieden, Dinge, die ihm gefallen aus der Geschichte
der Bildhauerei wieder aufzunehmen und in eine Form der Wiederholung
zu führen, ohne daß er sich selbst imitiert. Gironcoli
hat sich darin gefunden , Formales, das existiert, aufgreifend in
Arbeitsverbindungen zu führen.
Alte Gegenstände sind aus bestimmten Bedürfnissen und
Funktionen entstanden und sind in Rituale verwoben, so in ihrer
Existenz begründet. Die modernen Kunsteinrichtungen ritualisieren
sich anhand des prosaischen Seins.
|



|