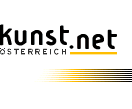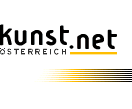|
Überlegungen zum Werk Alfred Haberpointners:
Haberpointners künstlerisches Material ist das Holz. Zum Einen
handelt es sich um konzentrierte, dichte Kernformen, zum Anderen
um lagernde, oft aus mehreren Teilen aufgebauten Quadern und zuletzt
um verhältnismäßig dünne Tafeln, die vor die
wand gestellt werden. Die ovalen oder runden, kugelförmigen
Körper wie die abgeschnittenen Stümpfe ordnet er zu Familien,
Gruppen miteinander ästhetisch kommunizierender teile; manche
Wände bestehen aus mehreren, aneinandergereihten Elementen.
Haberpointner entkleidet das Holz, die Rinde wird entfernt, ehe
er ihm mit unterschiedlichsten Instrumenten zu Leibe rückt,
mit Hacken und Sägen, Hämmern und Bohren aber auch mit
glühenden Stiften und
Brenneisen. Wer die Terminologie dieser letzten Sätze aufmerksam
liest, dem wird in der folge ein Begriff wie Folter und Schändung
nicht fremd erscheinen.
Es geht bei Haberpointner nicht um eine Naturidylle oder eine romantische
Sicht auf die Natur. Holz ist ein natürlicher Körper,
dem der Künstler in einem Prozess zusetzt, dessen Oberfläche
er verändert, schindet zerstört und zu einer neuen Ordnung
überführt. Dies geschieht nicht als Ritual der Abreaktion,
sondern ruhigen Blutes, denn die Spannung bei diesen Arbeiten besteht
in der Dialektik von Form und Prozess.
Nicht zuletzt auf Grund des Materials und der Wirkung des Lichts,
welches durch die von Hackespuren, Sägefurchen, durch stumpfe
Schläge eingedellten und strukturierten Oberflächen geleitet
wird, erscheinen uns die Arbeiten in einem romantischen Kontext.
Objekte die auch von der Natur selbst geformt hätten sein können,
wie Flußsteine oder Aststrünke, die vom Wasser behandelt
wurden, in langen Zeitperioden, Objekte die wieder in die Natur
zurücksinken könnten. Aber Haberpointner ist nicht Arp
oder Brankusi die das Holz bis zur Verleugnung des Materials poliert
hatten und Kernformen schufen, die die Konzentration von Natur darstellten,
sondern diesem Künstler geht es um die schöne Verletzung,
die Zerstörung als einem ebenfalls in der zeit sich vollziehenden
Prozess. Aufschlußreich war seine Erzählung eines Falles
in Amerika, wo zwei Halbwüchsige ein Kleinkind hinter sich
her zu Tode schleiften, von der mir der Künstler berichtete.
Trotz der Regelmäßigkeit der Struktur, etwa der eingebrannten
Nagellöcher, haben die Werke den Beigeschmack der Schändung
und Folter, sind Metaphern auch für Störung und Zerstörung.
An dieser Stelle muß bemerkt werden, daß die Arbeiten
nie unter eine bestimmte Größe absinken. Die Gegenwart,
die sie besitzen ist auch von ihrer Größe, ihrer Eigenschaft,
einen Raum zu besetzen, abhängig.
Antropomorphes ist nicht intendiert. Die Kugelform deutet nicht
auf den Kopf, die Stümpfe nicht auf den Rumpf hin. Es sind
allgemeine Formen, unterschiedliche Massen oder Flächen. Bei
den Flächen interessiert er sich für die Kontraste zwischen
der geometrischen Struktur der sich kreuzenden Furchen und die gewachsene
Struktur des Holzes in die diese Linien geschnitten wurden. Hier
wie auch in anderen Werken ist es die Dialektik der Strukturen,
die ihn fasziniert. Es wäre falsch Haberpointners Werk aus
einer formalen strukturellen Perspektive alleine wahrzunehmen. Die
Verletzungen schaffen eine Struktur, sind die Folge eines Prozesses,
der auch immer als solcher gelesen wird und dessen Inhaltlichkeit
wir geklärt haben es ist gerade die Tatsache, daß man
sein Werk auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig wahrnimmt, was seine
Qualität ausmacht. Dies gilt auch für die Farbigkeit sei
es die des Naturholzes oder eines kräftigen Rot (Blut) aschigem
Weiß (Todesstarre) oder Schwarz (Verbrennung) die abstrakt
wahrgenommen werden kann jedoch auch im Hinblick auf eine zu Grunde
liegenden Semantik darauf bezogen werden darf.
Text von Peter Weiermair aus dem Katalog: Alfred Haberpointner
Bilder Skulpturen 1999
|






|