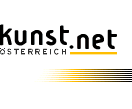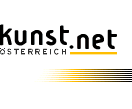"Ich strebe nach einer Kunst, die direkt an das Alltagsleben angeschlossen ist ...., die ein unmittelbares Ausströmen unseres wahren Lebens und unserer wahren Stimmung ist.“ Jean Dubuffet
I.
Gibt es eine analoge Direktheit, wie Dubuffet sie für die Malerei erstrebte, in der Skulptur? Oder verhindern Skulpturen mit ihrem Materialwiderstand einen umweglosen Zugriff von Kopf und Empfindung? Der Diskurs über zeitgenössische Skulptur erschöpft sich zumeist in der Feststellung
einer Verwendung und Adaption neuer Materialien, sowie einer Grenzüberschreitung und Vernetzung mit anderen Gattungen - und hier vor allem mit den Neuen Medien im Sinne eines erweiterten Kunstbegriffes. Peter Weibels Postulat, alle Disziplinen der Kunst wären von den Medien verändert worden – ihre Wirkung wäre universal und daher würde jegliche Kunstpraxis ihrem Skript folgen - , ist zwar aus seiner Position heraus verständlich, jedoch auch nur ein Standpunkt einer Kunstbetrachtung der Gegenwart. Michael Kos, ehemals Student bei Peter Weibel an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien, entwickelte sein künstlerisches Oeuvre bewusst abseits einer medienorientierten Kunstpraxis auf der Suche nach einer Vorgangsweise, die den Künstler nicht auf einen direktiven Regieplatz verweist, sondern eine prozessorientierte Auseinandersetzung mit den Bedingungen des Materials notwendig macht. So fand Michael Kos in der Bildhauerei, die er nach seinem Medienstudium begann, einen fundamentaleren Zugang zur modernen Kunst. Nicht zuletzt war auch die Lust an einer haptischen, manuellen Umsetzung einer Idee maßgeblich, deren materialisierte Erscheinungsform einen sinnlicheren und unmittelbareren Zugang ermöglicht, als es bei der Fotografie oder der Videokunst der Fall ist.
Speziell die Steinbildhauerei verweigerte sich (allein schon durch ihren langsameren Entstehungsprozess)
erfolgreich einer breiten Vereinnahmung durch die postmoderne Kunstpraxis.Was ihr nicht selten den
Vorwurf einbrachte, der akademischen Tradition zu sehr verpflichtet zu sein und den zeitgenössischen
Diskurs eines erweiterten Skulpturenbegriffes nicht aufzunehmen. Doch passieren Veränderungen nicht
auch allein durch das künstlerische Tun selbst, durch die Auseinandersetzung mit dem Material, welches
dann, der künstlerischen Konzeption folgend, eine „lustvolle Materialüberschreitung“ (Michael Kos)
und/oder eine Veränderung der Formensprache fordert?
Michael Kos Lazarett für Steine konfrontiert den Betrachter mit einer neuen Ästhetik innerhalb seines
Werkes und innerhalb der Steinbildhauerei im Allgemeinen. Die Steine und ihre Vernähung simulieren
eine Situation, die so real nicht existiert, und überschreiten dabei gleich mehrere Grenzen. Die Wirkung
ist unmittelbar – direkt und irritierend. Das Erfassen der Form und des Inhaltes schwankt zwischen
Ahnung und Verstehen, oder wie Augustinus es formulierte: „Wenn mich niemand fragt, dann weiß ich
es, wenn ich es aber jemandem erklären möchte, dann weiß ich es nicht.“
II.
Wenngleich viele der Steinskulpturen von Michael Kos der Wirkung einer präzisen Oberflächenbearbeitung folgen und der Form eine absolute Präsenz zubilligen, so verweigert sich sein
vielfältiges Oeuvre einer Standardisierung und Einordnung. Objektskulpturen aus Brotteig stehen
Brotlaiben aus Marmor und Skulptur-Installationen gegenüber, die sich zu einer Thematik aus dem
Alltagsleben und der kritischen Auseinandersetzung damit öffnen, mitunter mit sozialem Forscherdrang
und auch mit gewisser Ironie. Wie ordnet man nun ein, was man sieht? Ist Michael Kos ein Realist, der
zugleich auf Abstraktion,Volumen, Fläche und Raumdimension baut? Die Kontiguität seiner Skulpturen ist
zum Teil aus der Betitelung seiner Objekte zu erklären, Arbeiten wie Reisigstein (2004) oder Memo
(2004) evozieren diese durch die Hereinnahme divergierender Materialien. Besonders die Verbindung
von Reisig und Stein irritiert und stellt sich gegen die üblichen Rezeptionsgewohnheiten von
Steinskulptur. In der Arbeit Private Box (2004) geht Kos noch einen Schritt weiter. Raue, rissige
Steinplatten bilden eine Schachtel, die mit Hanfseilen zusammengehalten wird – zugenäht - mit einem
Steindeckel verschlossen. Hier realisiert Kos sein Konzept der additiven Steinskulptur, deren Volumen sich
über die Montage von Elementen ergibt. „Denken heißt Überschreiten“, schrieb Ernst Bloch, und so
denkt man sich in diese Box hinein. Ist das eigentliche Kunstwerk so kostbar, dass es durch diese schreinartige
Box mit ihren rohen Platten nur geschützt wird? Doch wäre wirklich etwas Reales in der Box,
würde dies nicht eine Vertreibung aus dem Paradies bedeuten, so wie Clemens Brentano es beschrieb,
als er erfuhr, dass sein phantastisches Königreich Vaduz, das er mit seiner Schwester Bettina am
Frankfurter Dachboden bewohnte, tatsächlich existierte? Es gleicht einem Paradoxon, dass hier eine
Skulptur steht, die als dreidimensionales Ding normaler Weise den realen Umraum für sich beanspruchen
und mit ihm korrespondieren sollte, sich diesem jedoch absolut verweigert, ja verwegener Weise
den Betrachter in einen neuen, sehr privaten Raum führt, ihn eine Schwelle überschreiten lässt, die er so
nicht erwartet hat.
III.
Ein Auswahlkriterium des Steinbildhauers orientiert sich üblicherweise an der Unversehrtheit des Steines
(vom "gesunden" Stein ist dann die Rede), an seiner stofflichen Makellosigkeit als Ausgangspunkt des
künstlerischen Formwillens. Im Gegensatz dazu macht Michael Kos Steine mit Vernarbungen und Rissen
zum Gegenstand seiner neuen Arbeiten. Skulpturen leichthändig wie Skizzen, deren Ideen sich in einer
präzisen und dichten Unmittelbarkeit ins Material eintasten. Skulpturen, die sich bereits in ihrer
Grundform einer Vollkommenheit entziehen. „Doch die Zielvorstellung Ideal“, so Ernst Bloch, „wirkt als
solche unerlässlich, ein auf sie gerichteter Willensentscheid ist unaufhebbar." Und er schreibt unerbittlich
weiter: „Er ist es selbst dann, wenn er nicht vollzogen wird, denn der Nichtvollzug wird gerade wegen
der sachlichen Unaufhebbarkeit von schlechtem Gewissen, mindestens vom Gefühl der Entsagung begleitet.“
Für die vom Künstler ausgewählten Steine bedeutet dies, dass sie, um eine als Ideal angenommene
Ganzheit zu erreichen, erst „behandelt“ werden müssen. Der künstlerische Eingriff, so Michael Kos, wird
solcher Hand zur Reparatur, zur Operation und Chirurgie. Doch selbst wenn Risse, Einschnitte und
geplatzte Adern vernäht werden, bleibt etwas Sichtbares zurück. Die Naht, die eine tiefer liegende
Wunde zudeckt, läßt, entfernt man die Fäden, stets noch die sichtbare Narbe zurück.
Der Künstler stellt damit eine elementare Frage: Sind Wiedergutmachungen tatsächlich möglich?
Erinnerungen sind von objektiver Seite nicht zugänglich, ebenso nicht wie der private Denkraum der verschnürten
Box. Erinnerungen ergehen sich immer in der Vergangenheit, laufen also den in die Zukunft
strebenden Menschen zuwider. Sie drängen sich, wie die von Michael Kos nun ausgewählten Steine, in
den Mittelpunkt einer gegenwärtigen Betrachtung und evozieren eine bestimmte proportionale
Einstellung dazu.Wenngleich diese nur fiktiv sein kann; denn was einst wahrgenommen wurde, existiert
so nicht mehr in der Gegenwart. Objektive Verfahren scheitern – die Erinnerung bleibt stets im Bereich
zutiefst persönlicher Bewusstseinszustände.
IV.
Zuvor war der Stein nur ein Brocken, hinsichtlich seiner Wahrnehmungsattribute in allen Richtungen
offen. Man konnte die Gesamtform erfassen, spitz, kugelig, abgerundet, an manchen Stellen ausgebuchtet,
oder man wanderte über seine Oberfläche, ertastete mit den Augen verschiedene Farbnuancen und
Einbuchtungen. Doch durch die Vernähungen von Michael Kos, zuweilen brutal mit knallrotem Seil, hebt
sich plötzlich in der Rezeption eine Richtung aus allen anderen hervor, wie eine Furche auf der zuvor
wenig differenzierten Oberfläche. Sie zwingt einem das Folgen-Müssen auf, sowohl mit den Augen als
auch mit den Gedanken. Doch ist die Naht eine Korrekturillusion, denn gerade dadurch, dass diese
Vernähung sich einem aufdrängt, entstehen Bilder aus einer Begegnung zwischen Sinnlichem und
Erinnertem, Assoziationen an etwas, das man schon einmal gesehen, gehört oder erlebt hat, und es
stolpert Vergangenes in die Gegenwart. Der Stein wird plötzlich als etwas Verletztes, Unvollkommenes
wahrgenommen. Dies steht jedoch im Gegensatz zu dem auratischen Versprechen, das in jeder
Kulturgeschichte diesem Material zugebilligt wird. Der Stein als Entität, als Kraftquelle, die einen bestimmten
Platz erst zu einem Kultplatz werden lässt, Findlinge, die ihre Umgebung magisch aufladen, Steine, die
im Taoismus genauso wie in der hebräischen Kabbala den Aspekt einer höheren Einheit beschwören.
Ebenso gilt seit jeher der Marmor als etwas Kostbares und wird stets auch in Verbindung mit den als vollkommen
geltenden Werken der italienischen Bildhauerei gebracht. Michael Kos widerlegt - indem er sich
nicht den idealen Bildhauerstein aus dem Marmor brechen lässt, sondern sich jener ebenfalls in der täglichen
Arbeit im Steinbruch zutage geförderten Findlinge annimmt - zugleich auch die dem Material zugeordnete,
besondere Wertigkeit. Die von ihm ausgewählten Findlinge und Bruchsteine sind Abfallmaterial,
sogenannte Wurfsteine, die gewöhnlich zu Schotter zerschreddert werden. Der Witterung ausgesetzt,
sind sie durch Zeit und Erosion zur gegenwärtigen, individuellen Gestalt geformt. Durch das bewusste
Hinweisen auf ihre Furchen, Risse und Bruchstellen betont der Künstler ihren Makel und stellt damit die
Vorstellung von Ganzheit zur Debatte. Doch was bedeutet Ganzheit - wann ist ein Stein - ein Kunstwerk
ganz, vollkommen? Ist im Sinne des Naturwissenschaftlers Konrad Lorenz die Ganzheit nur dann erreicht,
wenn auch die assoziativ verbundenen Elemente und Eigenschaften des Gegenstandes, die gleichwohl zu
seinem Wesen, zu seiner Bedeutung und Wirkung beitragen, einbezogen werden? Ist der vom Künstler
ausgewählte Stein nicht gerade deshalb vollkommen, weil er sich für die Umsetzung einer künstlerischen
Idee eignet im Sinne Kants, der sich von einer schulmeisterlichen Ästhetik und von einem „Gesolltsein“
in der Kunst abwendet, indem er das Vollkommene als „Verkörperung einer Idee in einer einzelnen
Erscheinung“ sieht? „Ich gehe davon aus, dass es das Vollkommene, das Ganze gar nicht gibt“, lässt Thomas
Bernhard den Musikkritiker Reger in seinem Werk Alte Meister erklären. „Erst wenn wir immer wieder
darauf gekommen sind, dass es das Ganze, das Vollkommene nicht gibt, haben wir die Möglichkeit des
Weiterlebens. Wir halten das Ganze und Vollkommene gar nicht aus.“
In der Installation seines Steinlazarettes und in den Vernähungen der darauf folgenden Werkserie geht
Michael Kos der diffizilen Frage von Ganzheit,Vollkommenheit, ihrer Beschädigung, Fragmentierung und
ihrer möglichen Wiederherstellung symbolhaft nach. Indem Michael Kos seine Vernähungen im Stein
durch einen einfachen, jedoch sehr effizienten Taschenspielertrick erreicht, erteilt er letztlich auch der
Möglichkeit einer Wiedergutmachung eine illusionäre Absage. Und das durchaus im übertragenen Sinn,
- was letztlich auch die Ausgangsfrage nach der Direktheit in der Skulptur beantwortet.
V.
„Wir wissen, dass das Verdrängte uns immer verfolgt.“
Jochen Gerz
©2005, Silvie Aigner, Kunsthistorikerin, Katalogtext „Wiedergutmachungen“
Verwendete Literatur:
Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Bd. 1, Frankfurt am Main 1959
Ernst Florey, Geist oder Automat: Spekulationen über das fühlende Gehirn, Kunstforum International Bd. 126/1994
Jochen Gerz im Gespräch mit J. Liechtenstein und G.Wajchman, in Kunstforum Bd. 128/1994
Thomas Bernhard, Alte Meister, Frankfurt am Main 1985
Michael Kos,TransSubstanz,Werkkatalog, Wien 2003
Michael Kos u. Egon Straszer, Dinge an sich, Wieser-Verlag, Klagenfurt 2004 |






|